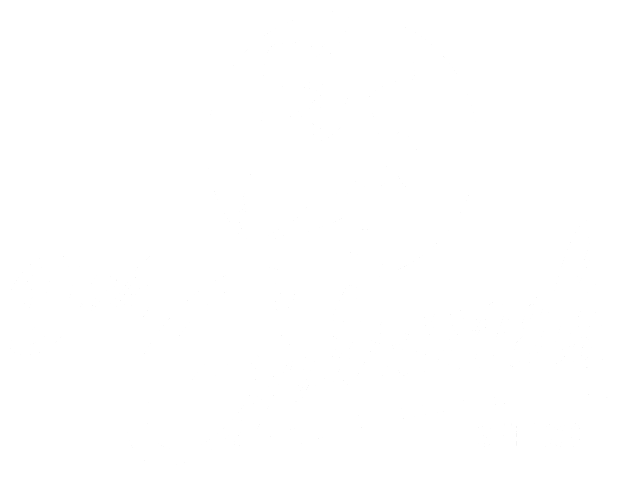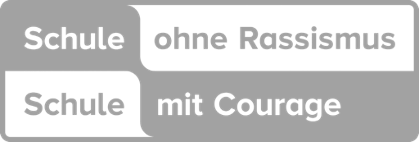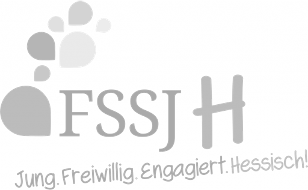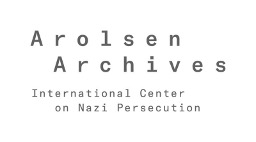Erstes Praktikum des Physik-LK der Q1 über elektrische und magnetische Felder
Die Rahmenbedingungen waren perfekt: Ein grauer Himmel und steter Nieselregen ließen beim Blick aus dem Fenster wenig Wehmut aufkommen. Gut, wenn man dann wenigstens Physiker ist und seine Zeit auch an den Experimentiertischen, in einem Fall sogar in der Dunkelkammer, fernab von den Launen des heimischen Wetters sinn- und gehaltvoll nutzen kann.
-

Der Hall-Effekt … -

… und die Aufzeichnungen dazu -

Das Fadenstrahlrohr -

Wenn es schwierig wird, hilft die Schulleitung -

Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld -

Ausmessung elektrischer Felder -

Führungsschiene für Dielektrika -

Öltröpfchen in der Schwebe – Der Millikan-Versuch
Das Thema für den ganzen Tag waren elektrische und magnetische Felder. In sechs Gruppen ging es dabei an die experimentellen Leckerbissen, die im Unterricht bisher ausgespart waren:
Die grundlegenden Eigenschaften und Kenngrößen eines elektrischen Feldes beobachtet man an einem Plattenkondensator. Mit einem eigens dafür angeschafften Elektrofeldmeter sind die Größen Feldstärke und Potential einer direkten und computergestützten Messung zugänglich. Dank eines kreativen Schubs der Experimentatoren gelang es, über den empfohlenen Aufbau hinaus eine Vorrichtung zu konstruieren, die das kontaktfreie Einfügen von Glas- oder Plastikplatten in das elektrische Feld bei gleichzeitiger Messung gestattete. Die beteiligten Schüler waren nur unter Androhung von Zwangsmaßnahmen von ihrem Experiment zu trennen.
Eine Alternative zur direkten Messung ist eine Spannungswaage. Hier kommt es auf experimentelles Geschick und gewissenhaftes Justieren des Aufbaus an. Der Lohn dafür ist die elektrische Feldkonstante.
Magnetfelder beschreibt man durch ihre Wirkung auf bewegte Ladungen. Sehr berühmt ist der Hall-Effekt, der die Herstellung eines Magnetometers oder Teslameters gestattet. Welche Materialien dafür besonders geeignet sind, konnte durch eine Versuchsreihe festgestellt werden.
Anhand der Bewegung von Elektronen in elektrischen und magnetischen Feldern lässt sich die spezifische Ladung des Elektrons, also das Verhältnis zwischen seiner Ladung und seiner Masse bestimmen. Im Fadenstrahlrohr kann man dabei eindrucksvoll sehen, wie die Elektronen von einem Magnetfeld auf eine Kreisbahn gezwungen werden.
Der berühmte Millikan-Versuch gestattet eine vergleichsweise präzise Bestimmung der Elementarladung, indem man die Bewegung mikroskopisch feiner Öltröpfchen im Feld eines Plattenkondensators untersucht – sofern es einem gelingt, die Tröpfchen im Mikroskop zu erfassen und zu vermessen. Mit großer Geduld und einer sich bald einstellenden Zerstäubungs- und Beobachtungsstrategie erzielten die jungen Forscher am Ende ein Ergebnis, das sie im Jahre 1910 auf die Liste der Nobelpreiskandidaten gebracht hätte.
Induktion ist die Grundlage für die Erzeugung und Umwandlung des elektrischen Stromes. Auch hier helfen Magnetfelder. In zwei aufwändigen Versuchen fand eine Gruppe junger Wissenschaftler heraus, wie Induktionsspannung und Änderung des Magnetfeldes zusammenhängen.
In allen Experimenten konnten die Schüler auf hochwertiges Material und moderne, computergestützte Messwerterfassung und -auswertung zurückgreifen. Erstmals kamen die universell verwendbaren neuen „Mobile Cassy“ zum Einsatz. Nicht nur die Physik hinter dem Experiment sondern auch die eingesetzte Technik wurden so gleichzeitig zur Herausforderung und zur Motivation.
Ein Physiker muss dem Kaffee zugetan sein und am Grimmels muss man zudem eine gewisse Zuneigung gegenüber einem deftigen Frühstück empfinden. Auch in dieser Hinsicht verlief der Tag ausgesprochen erfolgreich.