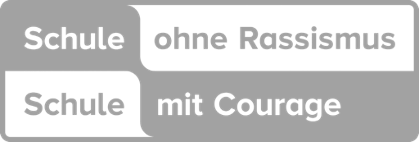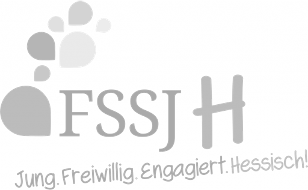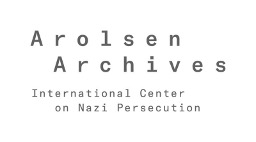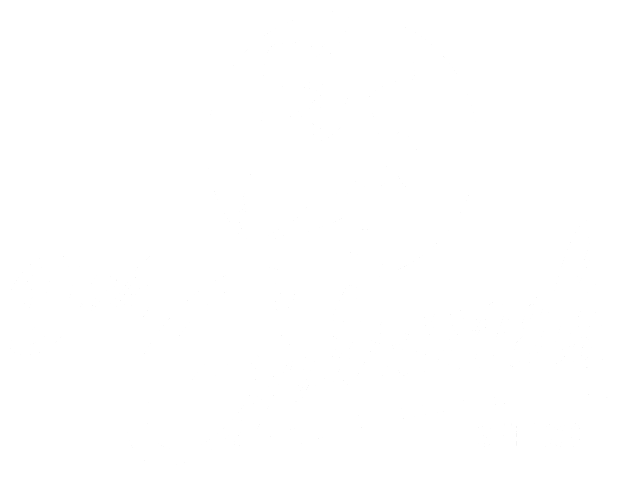Am 26. und 27. April führt die Theater-AG des Grimmelshausen-Gymnasiums in der Aula des GGG das Stück auf „Mit den Brüdern Grimm im deutschen Wald“. Beginn: 20.00 Uhr
Am 26. und 27. April führt die Theater-AG des Grimmelshausen-Gymnasiums in der Aula des GGG das Stück auf „Mit den Brüdern Grimm im deutschen Wald“. Beginn: 20.00 Uhr
Der Eintritt ist frei.
Hintergrundinformationen zur Theateraufführung am 26. und 27.April
Bettina von Arnim und die Brüder Grimm
Die Widmung der Erstausgabe der „Kinder- und Hausmärchen“ der Grimms von 1812 lautet: „An die Frau Elisabeth von Arnim“. Auch die nachfolgend von den Grimms verantworteten Ausgaben ihrer Märchensammlung sind Bettina von Arnim gewidmet, lediglich der Inhalt ihrer Anreden ändert sich und spiegelt auf diese Weise den wechselnden Einfluss Bettinas auf das Leben der Grimms wider.
Die Idee, eine Sammlung deutscher Volksmärchen zu veröffentlichen, stammt eigentlich von Bettinas Bruder Clemens Brentano und ihrem Mann Achim von Arnim. Deren Sammlung vorgeblicher „Volkslieder“, „Des Knaben Wunderhorn“, stieß sowohl in literarischen Kreisen als auch beim Lesepublikum auf unerwartet großen Zuspruch; diesen Erfolg wollte man mit einer Sammlung von Kinder- und Volksmärchen wiederholen und die Grimms boten sich an, dafür Märchen zu sammeln. Nachdem Clemens Brentano an diesem Projekt kein Interesse mehr zeigte, ermunterte Achim von Arnim die Grimms dazu, das Konvolut der bislang gesammelten Märchen 1812 selbst zu veröffentlichen. Ein Publikumserfolg wurde die Märchensammlung allerdings erst, nachdem die Grimms das Verkaufskonzept der äußerst erfolgreichen englischen Übersetzung Edgar Taylors von 1823 kopierten und 1825 – neben der großen zweibändigen, mit einem wissenschaftlichen Anhang versehenen Ausgabe – eine „kleine Ausgabe“ der „Kinder- und Hausmärchen“ herausgaben, die eine Auswahl der fünfzig populärsten Märchen umfasste.
1837 verloren die Grimms im Verlauf der Affäre um die „Göttinger Sieben“ ihre Anstellung als Bibliothekare und Professoren an der Universität Göttingen. Jacob wurde sogar des Lande verwiesen, weil ihm die Obrigkeit, zusammen mit seinen Mitunterzeichnern Dahlmann und Gervinus, anlastete, er habe das zunächst nur intern zirkulierende Protestschreiben gegen die Aufhebung der Verfassung durch Ernst August von Hannover publik gemacht. Vor allem dem Einfluss und dem diplomatischen Geschick Bettina von Arnims ist es zu verdanken, dass die Grimms 1840 von Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen wurden, um dort das „Deutsche Wörterbuch“ fertigzustellen. Allerdings bezogen die Grimms ihr Salär aus der Privatschatulle des Königs, denn Friedrich Wilhelm IV. hatte seinem Onkel Ernst August von Hannover versprechen müssen, den Grimms keine offiziellen Anstellung anzubieten. Als Mitglied der „Berliner Akademie“ durfte Jacob Grimm allerdings auch ohne ordentliche Professur an der Berliner Universität Vorlesungen halten. Bettina von Arnim lebte zu diesem Zeitpunkt schon lange in Berlin und nahm die alten Freunde aus Frankfurter Tagen gerne in ihren illustren Zirkel von Literaten und Intellektuellen auf. Diese Freundschaft sollte bis zum Tod von Bettina und Wilhelm im Jahr 1859 Bestand haben. Für einen zwischenzeitlichen Bruch sorgte allerdings 1844 Bettinas Eintreten für den politisch verfolgten Hoffmann von Fallersleben, der bei einem studentischen Fackelzug zu Ehren von Wilhelm Grimm frenetisch gefeiert wurde und so die Grimms – unabsichtlich – beim preußischen Hof in Misskredit brachte. Erst nach dem Tod ihres Gatten, Achim von Arnim, im Jahr 1831 entwickelte und entfaltete Bettina ihre ganzen politischen und literarischen Ambitionen. Bettina von Arnim gilt zu Recht als eine der ersten Vorkämpferinnen für Demokratie und die Rechte der Frauen; sie engagierte sich für die Emanzipation der Juden und setzte sich immer wieder resolut für politisch Verfolgte ein. Ihre 1843 veröffentlichte Schrift „Dieses Buch ist für den König“ beruht zum Teil auf eigenen Recherchen in den Elendsvierteln Berlins. Sie schildert darin die erschütternde Not und das soziale Elend der unteren Schichten, die von den Auswüchsen der industriellen Revolution am stärksten betroffen waren.
Zu unserem Theaterprojekt
Dem Faible Walt Disneys für die Märchen der Grimms ist es zu verdanken, dass die Figuren aus der Sammlung der Grimms inzwischen zum festen Bestand der Populärkultur gehören. Walt Disney und Hollywood haben ebenso dafür gesorgt, dass einige Mythen über die Entstehung der legendären Märchensammlung zum Gemeingut wurden. Diese Legendenbildung geht zum Teil auf die Grimms selbst zurück, die die Vorstellung verbreiteten auf einsamen Wandertouren durch oberhessische Dörfer den angeblich nur mündlich verbreiteten Märchenschatz dem Volk direkt abgelauscht und erstmals zu Papier gebracht zu haben. Diese Vorstellung ist aber genauso märchenhaft wie der Inhalt ihrer Märchensammlung selbst. Die Brüder Grimm haben ihre Märchen zunächst auf sehr vertrauten Wegen gesucht und gefunden, nämlich bei der Recherche in Bibliotheken. Ihre Zuträger entstammten ansonsten dem unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis, waren in der Regel weiblich und literarisch sehr gebildet: die Pfarrerstochter Friederike Mannel aus Allendorf, die Töchter der Familien Wild und Hassenpflug, von Haxthausen und von Droste-Hülshoff. Die einzige Märchensammlerin, die von den Grimms namentlich genannt wird, nämlich Dorothea Viehmann, war keineswegs, wie in der „Vorrede“ zur 2.Auflage von 1819 behauptet, eine Bäuerin, sondern Wirtstochter und Frau eines Schneiders. Während Jacob Grimm bei der Bearbeitung des gesammelten Märchenmaterials bestrebt war, den ursprünglichen „Volkston“ möglichst unverfälscht zu konservieren, drang Wilhelm Grimm darauf, die Märchen zu glätten, den Handlungsverlauf gängigen Erzählmustern zu unterwerfen und allzu Anstößiges (vor allem wenn es um Sexuelles ging) zu eliminieren. Der typische Sprachduktus der Grimm-Märchen geht auf den Einfluss Wilhelms zurück. Im Gegensatz zu Jacob, der sich bei seiner Sammeltätigkeit eher dem philologischen Ideal der Wissenschaftlichkeit verpflichtet fühlte, verfolgte Wilhelm bei seiner Redaktion der Märchen durchaus literarische Ambitionen. Auch das Erziehungsprogramm, das sich hinter den Grimm´schen Märchen verbirgt, die ja mit Bedacht als „Kinder- und Hausmärchen“ bezeichnet wurden, geht vor allem auf Wilhelm zurück. An erster Stelle in diesem Programm steht die Tugend der Treue; und seiner Treue hat es der Märchenheld, sei er noch so naiv und unbedarft, am Ende zu verdanken, dass er die Königstochter mitsamt dem Königreich gewinnt. Tugend überwindet so alle Grenzen einer ständischen Gesellschaft, was sich mit Blick auf die realen gesellschaftlichen Gegebenheiten im 19.Jahrhundert als reines Wunschdenken erweist. Alle Märchen der Grimms enthalten diese „Märchen-Wundermagie“, wie es der Philosoph Ernst Bloch ausgedrückte, und von daher geht es auch im ersten Teil unseres Theaterprojektes um das Wünschen und um die utopische Hoffnung, dass diesem Wünschen abgeholfen werden kann. Neben dem Wünschen und der Hoffnung auf Wunscherfüllung gesellt sich in den Märchen der Grimms aber stets als dessen Negativfolie die Erfahrung von Armut, Krankheit, Leid und Tod. Die Märchen der Brüder Grimm bleiben auf diese Weise in der Realität verwurzelt und spiegeln jenes soziale Elend wider, das Bettina von Arnim in ihrem Buch für den preußischen König anklagen wollte. Im zweiten Teil unseres Grimm-Projektes rücken wir daher die realistischen Elemente der Märchen in den Mittelpunkt, nämlich jene Erfahrungen sozialer und existentieller Not, der das Bedürfnis nach Wunscherfüllung zugrunde liegt. Paul Ciupka
Die Spieler und ihre Rollen
Adrian Hauptmeier: Jacob Grimm/ Pascal Marggraf: Wilhelm Grimm/ Annemarie Krüger: Bettina von Arnim/ Eddy Nuhi: Märchenerzähler, der böse Wolf, Zauberspiegel/ Jessica Erlenbach: Giftzwerg, die jüngste Tochter/ Alina Geilich: ältester Sohn, 1.Zwerg, hungernde Mutter/ Leonie Wagner: zweitältester Sohn, ältere Tochter/ Milena Gackenheimer: jüngster Sohn, 6.Zwerg, Teufel/ Franz Schwarzacher: kranker König, Rotkäppchens Großmutter, Holzhacker, Hexe, Gott/ Amanda Konieczna: verwünschte Prinzessin, Tod/ Nicolai Knoll: ein Vater/ Sarah Holzmann: junger Mann auf der Suche nach dem Grusel, Jüngling/ Selina Pudell: Rotkäppchens Mutter, 2.Zwerg, Bettelkind/ Elena Ullmann: Rotkäppchen, eine Königstochter/ Mahalia Slisch: böse Königin, Sterntaler/ Pauline Friedrich: Schneewittchen/ Lena Esch: Murmeltier (ein schläfriger Zwerg)/ Anna Schmidt: 3.Zwerg, Bettelkind/ Lisa Wies: 4.Zwerg, Gretel/ Olivia Altenhövel: Mädchen mit Laptop, Bettler, armer Mann/ Jana Laska: Junge mit Laptop, Hänsel, Bettelkind
Regieteam
Plakat: Pascal Marggraf/ Requisite: Annemarie Krüger/ Choreografie: Lena Esch/ Internet-Chat: Aurelia Fröhle, Annemarie Krüger/ Szenario: Paul Ciupka/ Spielleitung: Paul Ciupka, Christine Heinrich/ musikalische Leitung: Nicolai Knoll/ Beatboxing: Eddy Nuhi/ Licht- und Tontechnik: Moritz Englisch, Laura Johann, Nicolaus Klein, Kai Lippert, Steffen Schleuning, Benjamin Schlosser, Annika Schmütz, Jannik Senzel
Musik
Nicolai Knoll und wer noch??
Szenenfolge
1. „Das Wasser des Lebens
2. „Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“
3. „Rotkäppchen“
4. Ein Märchenchat
5. „Schneewittchen“
6. Teegesellschaft bei den sieben Zwergen
7. Über das Wünschen
Pause
- 8. „Hänsel und Gretel“/ „Die Kinder in Hungersnot“
- 9. „Sterntaler“
10. „Vom Gevatter Tod“
11. Happyend